
Meine Arbeit beginnt immer mit dem ersten Satz. So bringe ich auch Ihre Themen an die Öffentlichkeit.
Meine Kompetenz für Ihr Projekt!
unkompliziert, verlässlich und erfahren
Was ich für Sie tun kann, finden wir in einem unverbindlichen Gespräch gemeinsam heraus.
Details
Von der Idee bis zur Präsentation
unkompliziert, verlässlich und erfahren
Was ich für Sie tun kann, finden wir in einem unverbindlichen Gespräch gemeinsam heraus.
Meine Kompetenzen und Referenzen
Nutzen Sie einen der fünf Buttons um mehr über meine „Gewerke“ zu erfahren
SchreibWerk
In Wort und Bild kann ich herausstellen, was Sie zu bieten haben. Ich schreibe die passenden Texte für Ihr Unternehmen oder über Ihr Projekt. Verständlich und überzeugend. Immer nah dran.
Expertise
- Fernstudium literarisches Schreiben
- Journalistenschule der Friedrich-Ebert-Stiftung Text und Fotografie
- seit 2005 als freie Journalistin für regionale und überregionale Redaktionen tätig
Referenzen
- Redaktionen:
Bruderverlag | BR | HR | MDR | Wild und Hund - Tageszeitungen:
F.A.Z. | Werra-Rundschau - Publikationen:
Magazin „Der Teller der Pocahontas“ | Magazin „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ | „Hier leben Sie richtig!“ (Herbert-Quandt-Stiftung) | Mitarbeit bei Publikationen von Prof. Dipl.-Ing. Manfred Gerner - Information/Werbung:
Haustafeln Herleshausen | Texte für „Fachwerk ökologisch sanieren“ und „Essen & Trinken im Herzen Deutschlands“ (Julia Hintermann)
FachWerk
Die Herausforderungen für das Fachwerk sind groß. Als Fachjournalistin bearbeite ich Aufträge aus dem privaten und öffentlichen Bereich, der freien Wirtschaft, sowie Institutionen und Interessensgemeinschaften. Meine vielfältigen Einblicke, Erfahrungen und Kontakte bilden hierfür eine fundierte Grundlage.
Expertise
- Elterlicher Zimmereibetrieb
- Journalistenschule der Friedrich-Ebert-Stiftung Text und Fotografie
- Weiterbildungen bei der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V. (u.a. Denkmalschutz und Denkmalpflege, Fachwerkentwicklung; Holz und Verzimmerung)
Referenzen
- 2023: „Keynotespeaker“ beim Jahresempfang deENet Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologie e. V.
- ab 2023: Dozentin am BUBIZA Kassel für „Geprüfter Restaurator/in im Zimmererhandwerk – Master Professional für Restaurierung im Zimmererhandwerk“
Referentin in der Propstei Johannesberg Fulda – Seminar „Master Professional für Restauratoren im Handwerk / Upgrade“ - ab 2020: Mitglied Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz – AG Fachliche Fragen in der Denkmalpflege
- ab 2019: Mitarbeiterin der KEEA Klima und Energieeffizienz Agentur GmbH
- ab 2015: pro holzbau hessen – HolzbauCluster Hessen e. V.
- 2013: AG Gründung Fachwerk-Fünfeck
- ab 2012: Berichterstattung Fachwerk-Triennale 12 / 15 / 19
- ab 2011: Freie Mitarbeit für die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e. V.
- ab 2007: Gründung und Mitgliedschaft diverse Bürgerinitiativen
- Moderation von Fachveranstaltungen
WebWerk
Expertise
- seit 2012 Entwicklung und Überarbeitung von Texten in unterschiedlichem Kontext
- Erstellung und Anpassung von Bildmaterial
Referenzen
ProjektWerk
Meine Erfahrung: ein Projekt gelingt dann, wenn jeder seine Kompetenz einbringt und konstruktiv mitarbeitet. Meine Kunden schätzen mein Engagement und meine Fachkenntnisse, auch bei einer Moderation oder einem Vortrag.
Expertise
- Energetische Sanierung – Modellprojekt
- Baukultur und Stadtbild: energieeffiziente Fachwerkstadt
- Integrierte Entwicklungsansätze
- Klimaschutz in Fachwerkstädten
- Interkommunaler Hochwasserschutz Untere Werra
Referenzen
- Quartierssanierung im Werra-Meißner-Kreis
- Fachwerk-Triennalen 12 / 15 / 19
- Fachwerk5Eck Südniedersachsen
- KEEA Klima und Energieeffizienz Agentur GmbH
- Gründungsmitglied Hessischer Hof e. V.
- Mitglied in der Arbeitsgruppe „Fachliche Fragen der Denkmalpflege“ des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK)
NetzWerk
Vertrauen und Verlässlichkeit verbinden Menschen in einem Netzwerk. Dabei geht es nicht immer nur um wirtschaftliche Interessen, auch und vor allem im vernetzten Ehrenamt sehe ich einen wichtigen Mehrwert für die Gemeinschaft.
Wenn es passt, bringe ich Sie mit denen zusammen, die zu Ihrem Projekt passen. In meinen Netzwerken für
- Holzbau, Fachwerk, Denkmalschutz
- Energiewende, Hanf
- Naturschutz
- Bürgerinitiativen
mehr…
mehr…
Hier finden Sie vereinzelte Links zu Inhalten, an denen ich, teilweise im Kundenauftrag, beteiligt war.

Kunden-Feedback
„Die FachwerkAgentur entwickelte für unseren Webauftritt die Informationen über die Arbeit des Holzbau Clusters komplett neu. Das hochwertige Ergebnis ist der kompetenten und zuverlässigen Zusammenarbeit zu verdanken.“
„Die Zusammenarbeit mit Frau Wetzestein kann ich nur als Glücksfall bezeichnen, die Arbeitsergebnisse der „FachwerkAgentur“ sind zielorientiert und hochwertig, verlässlich und kreativ.“
Über mich
Machen ist das Wort, das mir am besten gefällt. Und mein Leben auf dem Land, mit einer immer größer werdenden Familie und unserem Fachwerkhaus.
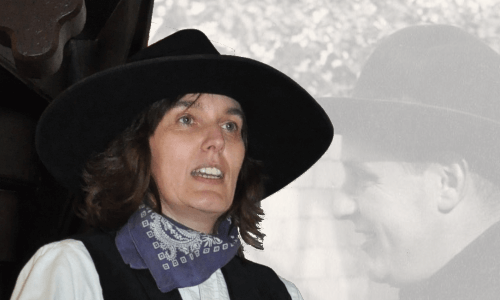
Mein Interesse für das Fachwerk habe ich geerbt. Von meinem Vater, dem Zimmermeister Karl Wetzestein.
Meine Lust am Schreiben habe ich entdeckt. Und vor vielen Jahren angefangen, für Zeitungen über meine Heimat zu schreiben.
Später wurde das SchreibWerk zu meinem HandWerk und zu meinem Beruf.
Vor allem sind es die oben aufgeführten „GeWerke“, die mich nicht nur interessiert und beschäftigt, sondern mir immer weitere Türen geöffnet haben. Im Jahr 2020 wurde ich in die Arbeitsgruppe „Fachliche Fragen in der Denkmalpflege“ im Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) berufen. Für mich persönlich der Beweis, dass Handwerk, Fachwerk und die eigenen Wurzeln, mein Leben begleiten und meine Resilienz positiv beeinflusst haben.
Vor allem sind es die oben aufgeführten „GeWerke“, die mich nicht nur interessiert und beschäftigt, sondern mir immer weitere Türen geöffnet haben. Im Jahr 2020 wurde ich in die Arbeitsgruppe „Fachliche Fragen in der Denkmalpflege“ im Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) berufen. Für mich persönlich der Beweis, dass Handwerk, Fachwerk und die eigenen Wurzeln, mein Leben begleiten und meine Resilienz positiv beeinflusst haben.
wichtig & aktuell
sind für mich auch andere Themen
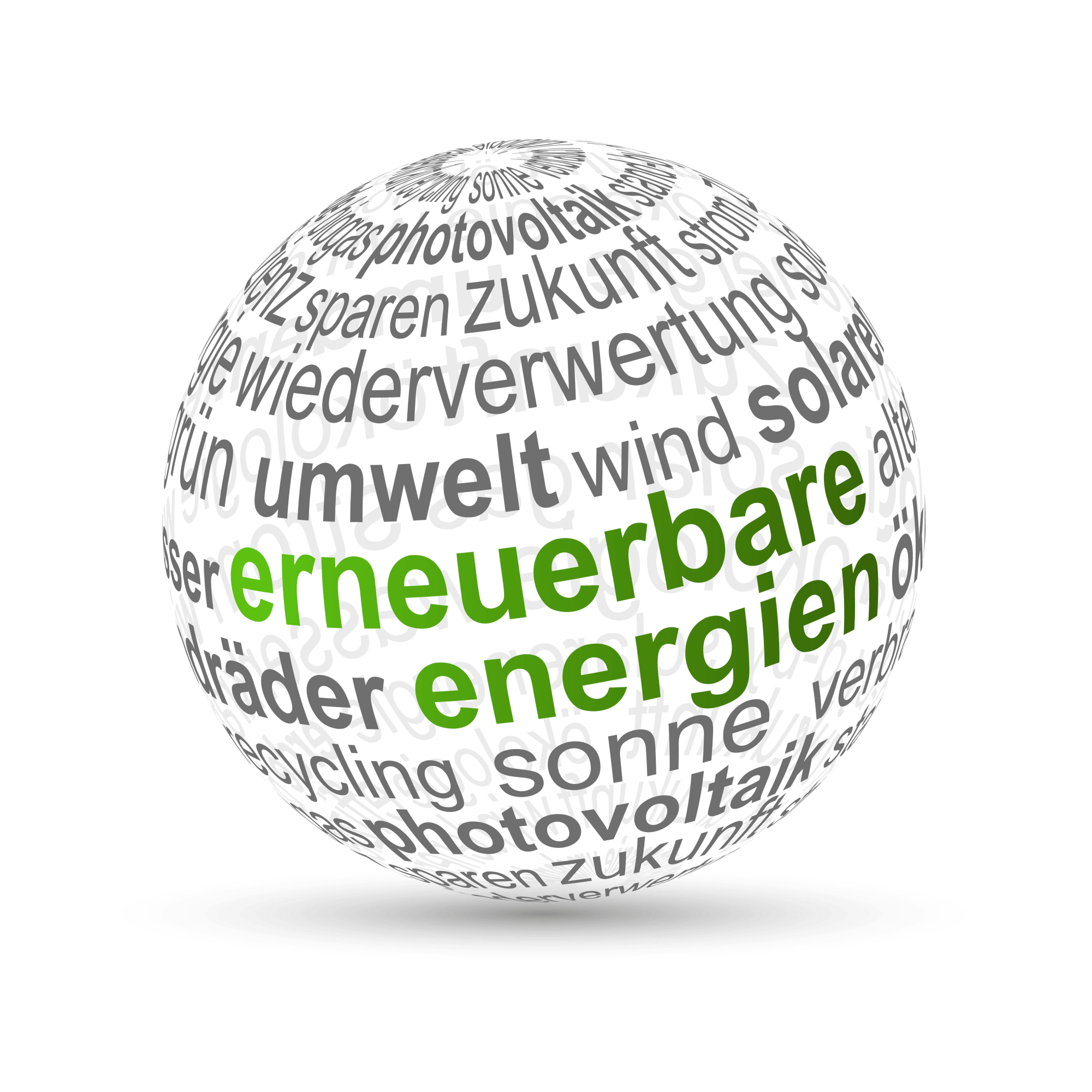
Klimaschutz
Jeder von uns muss jetzt seinen Beitrag leisten! Ein Weiter so ist nicht mehr möglich. Die Klimakrise ist JETZT und hört nicht einfach wieder auf! Ob wir das wahr haben wollen oder nicht, interessiert das Klima nicht.
Wir alle müssen dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen sofort drastisch reduziert werden. Vollbremsung. Nur so hat die Menschheit noch ausreichend Zeit, sich auf die Umweltveränderungen einzustellen, die wir im Anthropozän bereits ausgelöst hat. Schon jetzt sind wir im Wettlauf mit der Zeit, um Technologien zu entwickeln, die das Überleben sichern.
Nach Angaben der Weltwetterorganisation (WMO) ist es bereits jetzt 1,2 Grad wärmer als im Mittel des vorindustriellen Zeitalters (Mitte des 18 Jahrhunderts). Mit den derzeitigen Klimazielen als Reaktion auf die globale Erwärmung ergeben sich folgende Fakten für unser CO2-Budget:
- maximal 1,5 Grad Erwärmung: im Jahr 2030 zu 100% ausgeschöpft
- maximal 1,75 Grad Erwärmung: im Jahr 2030 zu 80% ausgeschöpft
Die aktuellen Zusagen der Klimaschutzmaßnahmen würden bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem durchschnittlichen globalen Temperaturplus von etwas unter 3 Grad führen. (Quelle: climateactiontracker.org)
Die 1,5-Grad Marke gilt als wichtiger Schwellenwert. In der Arktis schmilzt das Eis und legt dabei Gesteins- und Meeresoberflächen frei, die die Wärme der Sonne besser aufnehmen. Die lokale Temperatur steigt und bringt das Eis noch schneller zum Schmelzen. Ein ständiger Kreislauf, der die globale Erwärmung ohne weiteres menschliches Zutun unaufhaltsam ansteigen lässt.
Die Welt-Gesellschaft muss also mehr tun, und die Politik muss die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, um eine Zerstörung von unvergleichlichem Ausmaß zu verhindern. Die Welt-Gesellschaft, dazu gehört jeder von uns.
Durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern wie Erdöl und Erdgas entstehen große Menge an CO2, die in die Atmosphäre entweichen. Das zusätzliche CO2 in der Atmosphäre bewirkt eine menschengemachte Verstärkung des Treibhauseffekts und führt zu einer globalen Erwärmung mit elementaren und uns allen bekannten Auswirkungen. Trockenheit und Dürren / Stürme und Sturmfluten / Starkregen und Hochwasserereignisse / Hitzewellen.
Die Auswirkungen der Klimakrise sind weltweit spürbar. Millionen von Menschen haben ihre Heimat bereits verlassen müssen, Nahrungsmittelpreise steigen, hungernde Menschen demonstrieren und werden mit Waffengewalt zur Ruhe gebracht. Der Mangel an Wasser und Nahrung wird zum Konjunkturtreiber der Waffenindustrie. Und die aktuelle Pandemie zeigt, was passiert, wenn der Mensch der Natur zu viel Platz raubt.
Energieverbrauch halbieren, wäre eine erste Idee
Und noch was:
Weltweit nehmen Flächenbrände, Fluten, Stürme oder Wassermangel in den vergangenen 15 Jahren immer weiter zu. „Es ist eine gewaltige Aufgabe, zu verhindern, dass die Dystopie in die Realität schwappt. Wirtschaft, Politik, ganze Gesellschaften und jeder Einzelne müssen sich ändern“, schreibt Kurt Stukenberg am 16. September 2020 für den SPIEGEL in seinem Beitrag „Die Katastrophe ist da…“. Weiter heißt es, „der Internationale Währungsfonds schätzt, dass Regierungen die Nutzung fossiler Brennstoffe allein 2015 direkt und indirekt mit 4.700 Milliarden Euro subventioniert haben. Die Stromversorgung des Planeten bis 2050 weitgehend auf erneuerbare Energien umzustellen, würde laut der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien allerdings nur mit rund 405 Milliarden Euro jährlich zu Buche schlagen. Die Mächtigen der Welt müssten nicht in Panik verfallen, nur mit kühlem Kopf das Richtige tun.“ (Quelle: Spiegel online)
Naturschutz
Ich habe jetzt erst bewusst darüber nachgedacht, dass es seit fast 100 Jahren in Deutschland Naturschutzgesetze gibt. Vor 100 Jahren waren meine Großmütter junge Frauen oder Teenagerinnen, sie lebten mit satten Wiesen, intakten Wäldern, sauberen Flüssen und Bächen. Der Naturschutz war ihnen sicher noch fremd oder schlichtweg nicht nötig.
Als meine Großmutter Luise, geb. 1907, in den 1970er Jahren ihr Unverständnis über die Zerstörung der Natur immer wieder innerhalb der Familie Kund tat, schüttelten viele Erwachsene den Kopf. “Warum vergiften die denn alles?”, fragte sie und meinte die moderne Landwirtschaft, die ihrer Meinung nach Insekten und Tiere und am Ende auch den Menschen töten würde.
Sie hat Recht behalten. Obwohl sie nicht studiert hatte und keine wissenschaftlichen Studien über ihre Thesen vorweisen konnte. Sie hat es einfach gewusst. Und die Entwicklung der modernen Landwirtschaft – seit der Zeit ihrer Kindheit und als Tochter eines Landwirtes in Kleinern bei Bad Wildungen – mit dem verglichen, was in den Jahren des Wirtschaftswunders los war. Grausam war das für sie. Und sie musste das dann noch bis zum Jahr 2004 erleben und aushalten. Dass ihr jedes Kind leid täte, das noch in diese Welt geboren würde, habe ich sie oft sagen hören.
Was mir meine Oma mitgegeben hat und mir auch von meiner Mutter vorgelebt wurde, ist, dass die Natur nicht aufgeräumt gehört. Der Garten kann naturnah sein, Laub und Gras kann liegen und stehen bleiben, Stein- und Holzhaufen für Insekten die perfekte Behausung bieten, Tiere und Pflanzen werden nicht zum eigenen Spaß eingesperrt. Außerdem: Licht aus, ein Tropfen Öl verunreinigt 1000Liter Wasser, kein Plastik in die Landschaft; Müll, der im Wald beim Spaziergang gefunden wird, ist mitzunehmen!
Die Natur ist ein lebendiger Teil dieser Welt. Ein Lebewesen.
Darum müssen wir jetzt mehr denn je, die noch verbliebenen Lebensräume schützen. Dass wir jeden Tag Arten ausrotten, wissen wir. Dass wir jeden Tag zusehen, wie Wald verbrennt oder abgeholzt wird, wissen wir. Dass jeden Tag Millionen Liter von hochgiftigen Chemikalien in Flüsse und Meere geschüttet werden, Plastikmüll die Meere zum Müllcontainern macht, fossile Ressourcen ausgesaugt und seltene Erden ausgebeutet werden, all das wissen wir. Die Arten sterben, und auch die Menschen sind krank, psychisch und physisch.
Was wir tun können? Jeder einzelne muss Verantwortung übernehmen. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, die Gärten zu kleinen Oasen für Insekten und Tiere werden lassen, Plastik- und giftfrei. Und den Naturwald unterstützen, wo es ihn geben kann. Denn nur 5 % der Waldflächen in Deutschland sollen Naturwald werden.
Eigentlich sollte das bis zum Jahr 2020 passiert sein. Das Ziel wurde aber bei weitem verfehlt. Es werden immer noch 97% der Wälder mehr oder weniger intensiv bewirtschaftet. Dabei ist das leicht: Einfach den Wald in Ruhe lassen und das auf einer großen zusammenhängenden Fläche. Ein einfacher Beitrag zum viel Klimaschutz. Und der Holzbau ist nicht gefährdet und der Wald darf dabei beobachtet werden, wie er auflebt.
Leider findet die Menschheit offenbar keinen Konsens bei der Rettung der Erde. Wir, die wir in der sogenannten 1. Welt leben, haben die Wahl, wir können uns Naturschutz leisten. Wir dürfen nicht danach schauen, was die anderen nicht tun, sondern müssen das machen, was zur Rettung der Erde und aller Lebewesen, was zur Rettung der Natur als Lebewesen führt. Naturschutz ist einfach: Weniger Fleisch essen, weniger Plastikartikel kaufen, einen schönen Naturgarten anlegen, der lebendig ist. Und sich jedes Jahr verändert. Meine Großmutter würde sich darüber sehr freuen.
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Es ist ein spannendes Thema, das uns mehr verbindet, als trennt. Kulturell bedeutende Gebäude für nachfolgende Generationen zu erhalten, das ist die Aufgabe der Denkmalpflege. Jede DenkmalpflegerIn hat also erst einmal „nur“ die „Schätze“ zu bewahren, die ihr in dieser Funktion in Obhut gegeben wurden.
Ich finde es schön, durch historische Ortskerne zu schlendern. Vor allem die Fachwerkhäuser beeindrucken mich. Jedes Haus hat ein anderes Gesicht, die Konstruktionen, die Dächer, Fenster und Türen, Nebengebäude oder Gartenzäune unterscheiden sich. Heute kann ich die Balken lesen, wie ägyptische Hieroglyphen. Natürlich kommen bei meiner Übersetzung keine Texte heraus, aber die Geschichten darüber, warum der Zimmermann die Hölzer auf diese Weise abgebunden hat, was reine Zierde und was konstruktive Innovation darstellt, das kann ich sagen. Und kann mich dabei selbst von dieser Baukunst immer wieder vollends einnehmen lassen.
Wenn ich dann noch von den Geschichten erfahre, die sich hinter den Fassaden abspielten, wenn mir jemand davon erzählt, die Türen und Fenster öffnet, die Straßen und Plätze mit Bildern und Emotionen wiederbelebt, spüre ich, wie wertvoll jedes einzelne Gebäude ist. Jedes Gebäude ist also ein offenes Hausbuch, in dem alle Geschichten und viel Energie dokumentiert werden.
Wer in so einem Gebäude lebt oder eins erwerben will, trägt dazu bei, bestehende Ressourcen zu nutzen und dieses Hausbuch weiterzuführen. Der Denkmalschutz hat dafür gekämpft. Es war ein Kampf um jedes Stück Geschichte. Doch dieser Kampf muss jetzt zu einem Miteinander werden, weil die Zeit dafür reif ist.
Bürgerwille
Nachhaltiges Bauen ist auch Denkmalpflege, den es bedeutet, Bauwerke zu errichten oder den Gebäudebestand zu erhalten. Bestandsgebäude prägen das Erscheinungsbild unserer Städte und Gemeinden. Sie erleben langfristig eine hohe Wertschätzung.
Die Geschichte von Denkmalschutz und Denkmalpflege ist immer noch nicht ausreichend bekannt. Zudem sind allein schon die Worte negativ besetzt bei Gebäudeeigentümern. Die Erfahrungen der späten 1970er und 80er Jahre wirken nach.
Dabei gingen den aktuellen Denkmalschutzgesetzen der Länder lautstarke Proteste von Bürgern und sogar Straßenkämpfe gegen den Abriss von Gebäuden oder ganzen Straßenzügen voran. Wer weiß schon, dass im Jahr 1878 der Abriss des Alsfelder Rathauses für einen Aufstand der Bürger und am Ende für ein modernes Denkmalschutzgesetz im Jahr 1902 sorgten? Die Flächensanierungsvorhaben im Frankfurter Westend wurden in den 1970ern durch die legendären Häuserkämpfe verhindert und danach das Denkmalschutzgesetz von 1902 angepasst.
Graue Energie
Wir haben es Bürgerprotesten zu verdanken, dass es den Denkmalschutz von heute gibt. Er hat sich etabliert und ist fähig, sich der Zeit anzupassen. Seit der Zeit, als die Alsfelder Bürger um ihr Rathaus bangten, haben sich die Umweltbedingungen dramatisch verändert. Die globalen CO2-Emissionen wurden von den Menschen auf das 35.000-fache hochgetrieben.
Heute wissen wir, dass ein Haus, das mehr als einhundert Jahre alt ist, seinen Beitrag zu Nachhaltigkeit geleistet hat. Denn die Menge an Energie aus fossilen Brennstoffen, die für die Herstellung, den Transport, die Lagerung, den Verkauf und die Entsorgung eines Gebäudes aufgewendet werden musste, ist gering. Historische Gebäude stellen hier alle anderen weit in den Schatten. Schließlich waren diese fossilen Brennstoffe zur Bauzeit noch wenig im Einsatz. Da diese sogenannte „graue Energie“ den größten Anteil an der Gesamtenergiebilanz eines Gebäudes hat, gibt’s hier schon einmal Vorschusslorbeeren.
Die Energiemenge, die für den Betrieb eines alten Gebäudes nötig ist, stellt nur einen geringen Anteil der während des Lebenszyklus benötigten Energiemenge dar. Bereits verhältnismäßig kleine Maßnahmen zur energetischen Sanierung wirken sich, auf die Lebenszeit gerechnet, aber wiederum positiv auf die Energie-Bilanz des Bestandsgebäudes aus.
Eigentum verpflichtet – im Grundgesetz verankert
Wenn Eigentümer in ihr Haus investieren, wenn sie darin Miet- oder Wohnfläche für andere einrichten oder es selbst nutzen und die Ausstrahlung verbessern, wirkt sich das positiv auf das direkte Umfeld aus. Bereits 1919 wurde in der Weimarer Verfassung unter § 153, Absatz 3 die Sozialpflichtigkeit festgeschrieben mit „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste.“
„Eigentum verpflichtet“, heißt es auch heute noch im Grundgesetz. Das steht unter Artikel 14, Absatz 2 und sagt aus, dass jeder, der Eigentum erwirbt, dadurch eine Verpflichtung eingeht. Ein Artikel aus zwei Wörtern? Nein, auch diesem Satz, der zur Redewendung geworden ist, folgt ein zweiter nach, den kaum jemand noch parat hat: „Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“, sprich, wer selbst genug Eigentum hat, stellt den Überschuss anderen zur Verfügung, vermietet es und erhält es zu diesem Zweck.
Wo die Menschen gern leben
Wenn wir an einen Ort kommen, der uns fremd ist, dann sind es die Geschichten über die Menschen, erzählt von einem Stadtführer oder einem Einwohner, die mich dem Ort näherbringen. Die Phantasie kann die Geschichte lebendig werden lassen, die Häuser, Straßen und Plätze sind noch da, sie bekommen eine kulturelle und emotionale Bedeutung. Geschichten, wie die über die Rettung des Alsfelder Rathauses oder den Frankfurter Häuserkampf scheinen nur kleine Anekdoten einer langen Kulturgeschichte zu sein, sie zeigen aber, wie auch kleine Initiativen sich auch hunderte von Jahren später noch auswirken.
Erst durch die Kenntnis über die Geschichte wird der ideelle Wert eines Gebäudes spürbar, erst dadurch wird gar die Eigenschaft, Identität zu stiften, deutlich. Es geht uns alle etwas an, wenn über Sanierung, Umnutzung oder Abriss von Gebäuden diskutiert wird. Unabhängig davon, ob die für uns persönlich wichtig sind und unabhängig davon, ob es sich um Privathäuser oder öffentliche Bauten handelt. Die DenkmalpflegerIn hat von unseren Vorfahren und von uns den Auftrag bekommen, darauf zu achten, dass unsere Schätze auch in Zukunft noch unsere Geschichte erzählen können. Der Dankmalschutz ist deshalb eine sehr gute Idee der Bürgerinnen und Bürger aus dieser und aus vergangener Zeit.
Das Gebäude schützt seit Jahrtausenden Menschen und Tiere. Nicht nur darum haben historische Gebäude es verdient, erhalten und weiterhin bewohnt zu werden. Gepflegt und beschützt, können sie viele hundert Jahre ein Dach über dem Kopf bieten.
Die CO2 Uhr
(https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html)
Übersetzung: Martin Auer, Scientists for Future Österreich
Kontakt
Ich freue mich über eine Mitteilung und melde mich schnellstmöglich zurück.
* Bitte alle 4 Felder des Kontaktformulars ausfüllen.

